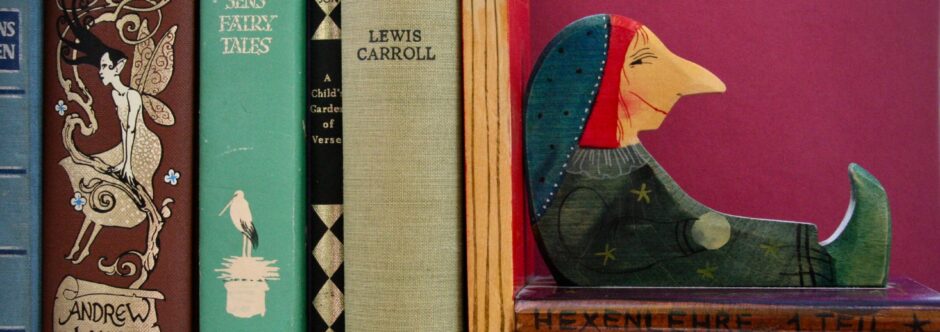Boston (Andrew Spencer/unsplash)
Bill war nicht nur mein Kollege, sondern vor allem ein wirklich guter Freund, mit dem ich die merkwürdigsten Situationen und Begegnungen erlebt habe – in seinem und meinem Leben. Wir haben die Höhen und Tiefen des anderen begleitet, einander bei Beziehungskrisen, Neuanfängen und Verlusten getröstet, uns miteinander gefreut, wenn der andere über beide Ohren verliebt war oder vor lauter Glück komplett over the moon.
Oft haben wir einander aber auch einfach nur zugehört oder geschrieben. Ich habe viele Briefe von Bill, vor allem aus seiner Zeit in München (Ich weiß noch, wie ich am Tag seines Umzugs abends beim Kochen vor Abschiedsschmerz in meine Nudeln weinte, während der arme Bill zeitgleich an irgendeiner süddeutschen Autobahnraststätte den Umzugswagen partout nicht mehr starten konnte und vor Stress ausflippte. Sein Ex hatte keinen Führerschein und flippte noch viel mehr aus!) und während seiner Aufenthalte in Maria Laach, wo er in Stresszeiten versuchte, Frieden zu finden. Die katholische Vergangenheit war nur eine unserer Gemeinsamkeiten, wir haben beide als Kinder jahrelang Klosterschulen besucht. Zudem hatten wir viele gemeinsame Freunde, Bekannte und Kollegen, die meisten sind mir in den Wirren des Lebens leider verloren gegangen.
Ich holte seine Koffer ab, als sein langjähriger Freund (besagter Ex) ihn in einer üblen Nacht-und-Nebel-Aktion urplötzlich an die Luft setzte. Ich schleppte die Koffer, während Bill frierend unten vor dem Haus stand und auf mich wartete. Die Koffer hatten im Treppenhaus vor der Tür gelegen, die Wohnung durfte ich, weil ich ja mit Bill befreundet war, nie mehr betreten. Den Rest seiner Sachen warf der Ex einfach aus dem Fenster auf die nasse Straße. Es war wie in einem schlechten Film. Wir fanden für Bill eine vorübergehende Unterkunft und dann gingen wir auf Wohnungssuche. Aber das war schon damals in Köln alles andere als einfach. Vor allem, wenn man Ausländer und schwarz war. Bills Ex sah ich danach nie wieder.
An seine Wohnungen, Zimmer und die gemütlichen „Ecken“ (als er noch mit besagtem Ex lebte) kann ich mich gut erinnern. Später, als er allein wohnte, waren seine Räume einfach, aber mit viel Geschmack eingerichtet, die Bilder an seinen Wänden waren sorgsam ausgewählt. Bill liebte Kunst. Und er hatte den sechsten Sinn, was Schätze betraf, die andere achtlos dem Sperrmüll opferten. Oft ging er abends durch die Straßen und rettete Möbel und Gegenstände, die dann bei ihm einen Ehrenplatz bekamen und von Besuchern bewundert wurden. Loot nannte er das.
In Los Angeles habe ich Ende der 1980er Jahre seine Familie besucht, seine beiden Schwestern und seine Mutter Georgina kennengelernt, die danach auch mehrfach in Köln war, und dort in ihrer Küche die ersten Sweet Potatoes meines Lebens gegessen. Damals dachte ich, es wären besonders leckere Karotten. Ich liebe Süßkartoffeln!
Boston

mit Bill in der Eifel
Geboren wurde Bill am 18.7.1947 in Boston, Massachusetts, hat dort die High School besucht und kam in den 1970er Jahren nach Europa, wo er in Paris, München, aber vor allem in Köln lebte. Er studierte in Bonn und Köln Anglistik und Geschichte und war wie ich lange Dozent für Englisch an der VHS und der Fachhochschule in Köln. Wir haben oft gemeinsam übersetzt, vor allem medizinische Texte, Kunstbücher und knifflige Museumskataloge. So eng zusammen zu arbeiten, zu recherchieren oder zu schreiben kann leicht in Stress ausarten, doch bei uns endete es ausnahmslos damit, dass wir immer alberner wurden, weil wir nach dem stundenlangem Brainstorming nichts und niemanden mehr ernst nehmen konnten, schon gar nicht uns selbst und die bescheuerten Texte, mit denen wir uns herumschlugen. Raumgreifende Kontextualität des Kunstwerks? Hell! What a bunch of baloney! Ha! Was für ein Schwachsinn! Wir kicherten, bis wir nicht mehr konnten.
Einmal verbrachte Bill zwei Stunden damit, ein ihm unbekanntes merkwürdiges deutsches Wort in seinen Nachschlagewerken zu suchen, das im Manuskript einfach nur falsch geschrieben war, bevor er mich endlich anrief und ich ihm die Wahrheit vorsichtig nahebrachte. Bill, it’s only a spelling error!!! Bill blieb einen Moment die Luft weg, dann stieß er einen üblen amerikanischen Fluch aus und lachte. Holy shit, I should have rung you three hours ago!
Vor 41 Jahren: Amerika Haus
Ich lernte Bill 1982 bei einer (ansonsten extrem langweiligen) Feier im Kölner Amerika Haus kennen, und wir merkten sofort, dass wir genau auf derselben leicht schrägen und ironischen Wellenlänge waren. In all den Jahren sprachen wir fast ausschließlich Englisch miteinander, er amerikanisches, ich britisches, was oft genug für Missverständnisse und Heiterkeit sorgte. Ich brauchte nur wieder mal seinen Sweater als Jumper zu bezeichnen oder er meine Trousers als Pants, schon mussten wir beide grinsen. Damals hatte ich eine Vorliebe für ausgefallenes Schuhwerk, und ich höre ihn noch sagen: „I really like your shoesies, kid.“ Von Bill lernte ich viele nette Idioms, etwa „to be up shit creek without a paddle“, was diverse Lebenssituationen hervorragend beschrieb, und „when the shit hits the fan“, das mir im Moment in unserer verrückten Welt wieder besonders häufig in den Sinn kommt.

Beacon Hill (Andrew Spencer/unsplash)
Lange war ich die deutsche Stimme der Schriftstellerin Charlotte MacLeod, und da viele ihrer Romane in Boston spielen, war Bill mein hilfreicher wandelnder Stadtführer, der vor Geschichten und Anekdoten nur so sprudelte. Ah, Boston!
„And this is good old Boston, The home of the bean and the cod, Where the Lowells speak only to Cabots, And the Cabots speak only to God.“
Bei Bedarf (also oft!) trafen wir uns zu kurzen oder langen Fragestunden, nahmen uns viel Zeit, es gab Tee und Plätzchen und manchmal auch American Cheese Cake. In besonders komplizierten und dringenden Wortsuchfällen oder Lebenskrisen wussten wir beide, dass wir den anderen jederzeit anrufen konnten, selbst spätabends, mitten in der Nacht oder in aller Herrgottsfrühe. Bill übersetzte und schrieb merkwürdigerweise am liebsten nachts, er konnte sich offenbar nie an die europäische Zeit gewöhnen. Im krassen Gegensatz zu mir arbeitete er am besten unter extremem Zeitdruck. Bei Stress lief er zu Hochform auf, während ich bei Stress wie gelähmt bin. Ich weiß noch, wie wir kurz vor Mitternacht gemeinsam seine Magisterarbeit zur Post im Hauptbahnhof trugen wie einen kostbaren Schatz, damit sie auch ja am nächsten Tag pünktlich ankam. Wir hatten damals beide kein Internet und ich ahne, wie Bill damit umgegangen wäre. Ich fürchte, er hätte sich extrem schwergetan. Technik hat er gehaßt. Ihm war schon der „Computer an sich“ extrem unheimlich, und er gestand mir einmal, dass er das komische Gefühl nicht loswürde, dass eines Tages eine fette Faust direkt aus dem Monitor schießen und ihn kalt niederstrecken würde. Ehrlich gesagt konnte ich das gut verstehen. Genau das traute ich meinem Atari mit all seinen Bombendrohungen auch zu.
Bill konnte hervorragend kochen und backen, er servierte mir meine erste und köstlichste Pumpkin Pie und lud mich jedes Jahr am 1. Januar zu einer Riesenschüssel Boston Baked Beans ein. Auf seinem Balkon stand immer ein Kasten mit Kräutern, und im Sommer denke ich manchmal an ihn, wenn ich die runden Thymianblätter zwischen den Fingern zerreibe. Boston Baked Beans habe ich leider nie wieder gegessen.

Mit Bill in Maria Laach
Als die Festplatte meines Computers einmal mitten in einer Buchübersetzung (einem echt schwierigen Buch über Katzenrassen und Rassestandards), wie bereits gesagt in VOR-Internet-Zeiten, unerwartet mit einem leisen Knattern ihren Geist aufgab und ich am Rande des Nervenzusammenbruchs stand, erschien noch am selben Abend mein Freund Bill vor meiner Tür, mit einem Strauß Pfingstrosen und seinem hervorragend transportierbaren alten „Kellerfenster“ Mac, auf dem ich dann problemlos weiter übersetzen konnte. Damals gab es zwar noch keine Cloud, aber Disketten, so dass ich nicht den ganzen Text verloren hatte. Die Festplatte war Schrott.
Philadelphia
Anfang der 90er Jahre merkten seine Freunde, dass er schlecht aussah und immer hagerer wurde. Lange wagten wir nicht, ihn darauf anzusprechen, und taten so, als wäre alles in Ordnung. Das Thema AIDS war für ihn tabu, vor allem die damals sehr umstrittenen AIDS-Tests, auch als uns allen klar war, dass er mit Sicherheit infiziert war. Er muss von der Infektion bereits im Krankenhaus erfahren haben, als man ihn wegen einer schweren Herpesinfektion behandelte, sagte aber nichts. Erst als 1994 der Film „Philadelphia“ in die deutschen Kinos kam, konnte er offen über seine Erkrankung sprechen. Über den Tod oder Sterben redete er nie mit mir, wollte wohl auch seinem damaligen jungen Freund nicht alle Hoffnung nehmen. Er machte auch bewußt kein Testament, als könne er dem Tod dadurch irgendwie entkommen. Die neuen Medikamente, mit denen heute so vielen wirksam geholfen wird, konnten ihn nicht mehr retten, wahrscheinlich war seine Krankheit zu dem Zeitpunkt schon zu weit fortgeschritten.
Er durchlitt eine schwere Zeit, die er tapfer ertrug. Bis zum Schluss versuchte er zu arbeiten, nahm seine Übersetzungen mit in die Klinik und schrieb, bis ihm die Hände nicht mehr gehorchten. Kurz vor seinem Tod gestand er mir, er habe keine Kraft mehr und fühle sich mit dem Port und all den Verkabelungen und Infusionen gar nicht mehr wie ein Mensch, sondern nur noch wie eine Maschine. Es war hart, ihn zu besuchen, jedes Mal, wenn ich aus der Isolierstation kam, hätte ich am liebsten stundenlang geweint.
Vor 25 Jahren: Melaten
Bill starb am 5. Oktober 1998 und wurde auf Melaten bestattet. Ich fürchte, dass sein Grab inzwischen eingeebnet ist, denn ich habe dort kürzlich mehrfach nach Bill gesucht und konnte ihn nicht mehr finden.
Ich erinnere mich an seinen Humor, seine Großzügigkeit, seine Ironie, sein Lachen, seine schelmische Art, seinen scharfen Verstand und seine ebenso scharfe Zunge (besonders, wenn er jemanden nicht mochte), an seine gelegentliche Pingeligkeit und eindrucksvolle Dickköpfigkeit. You don’t know me, I can be extremely stubborn. Ich erinnere mich an seine Stimme, die immer noch auf den Kassetten meines uralten Anrufbeantworters ist. Ich erinnere mich an seine vielen, vielen Bücher, an den alten Setzkasten im Flur, in dem er winzige Steine, Muscheln und Federn aufbewahrte. Ich erinnere mich an seine Lebensfreude und seine Jungenhaftigkeit. Ich denke an ihn, wenn ich Tracy Chapman, Marla Glen, Eric Satie, französische Chansons und Bruce Springsteen höre. Ich denke an ihn, wenn ich Darjeeling Tee trinke, das Wort „Boston“ sehe und durch die Kölner Straßen gehe, in denen er gewohnt hat.

Bill am Aachener Weiher (BFL)
Bill ließ sich gar nicht gern fotografieren, daher habe ich nur sehr wenige Bilder von ihm. Leider kein einziges wirklich gutes. Meist ist auf den Fotos nur vage hinter oder neben mir zu sehen. Seine inzwischen längst verstorbene Mutter, die bis zum Schluss der Meinung war, ihr Sohn wäre ein Professor, schickte mir kurz nach seinem Tod einige Kinderfotos und erzählte mir bei ihren Besuchen hier viele Geschichten. Wie sie in den harten Bostoner Wintern bis unters Dach eingeschneit waren und das Haus erst verlassen konnten, nachdem sie einen Tunnel gegraben hatten, und wie Little Billy vor lauter Wut einfach den Halloween Kürbis „verhexte“, so dass er innen drin völlig faul war, als man ihm ein Gesicht schnitzen wollte. Little Billy stand daneben und grinste zufrieden. It was Billy who put a hex on that pumpkin!
Einmal habe ich es tatsächlich geschafft, Bill zu fotografieren. Wir saßen entspannt am Aachener Weiher in der Sonne, er schwärmte von seinem neuen Freund in München und passte einen kleinen Moment lang nicht auf – und schon hatte ich endlich ein Foto, auch wenn er darauf komischerweise eher grumpy als happy aussieht.
Vor zehn Jahren: NAMEN UND STEINE
Am 28. Juni 2013 wurden bei einer kleinen Gedenkfeier im „Kalten Eck“, dem Denkmal gegen das Vergessen, in der Kölner Altstadt Markmannsgasse/Rheinuferpromenade, wie jedes Jahr neue Namenssteine für an AIDS verstorbene Menschen eingelassen. In diesem Jahr waren es nur zwei Namen, Bill Mickens war einer davon. Den Stein habe ich gestiftet. Ich hoffe, dass er dazu beitragen kann, dass die Erinnerung an meinen amerikanischen Freund nicht verblasst. Es war ungewöhnlich windig an diesem Tag, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mein Blatt wegwehen würde, als ich etwas verloren hinter dem Mikro stand und versuchte, den mir völlig fremden Menschen, die sich hier versammelt hatten, von Bill zu erzählen. Ich war aufgeregt und bewegt, fürchtete, dass mir die Stimme versagen würde, aber ich habe es dann doch irgendwie geschafft.
Bills Stein lag von mir aus gesehen rechts. Am Ende der Feier war er bedeckt mit Blumen.

Kaltes Eck, Köln (BFL)
1988 wurde der 1. Dezember von der WHO zum Welt-AIDS-Tag ausgerufen. Heute ist der 1. Dezember. Das Motto in diesem Jahr lautet „Leben mit HIV – anders als du denkst?“ Zudem wurde vor vierzig Jahren die Deutsche Aidshilfe gegründet, hier in Köln gibt es dazu in diesen Tagen etliche Vorträge, Diskussionen und Veranstaltungen.